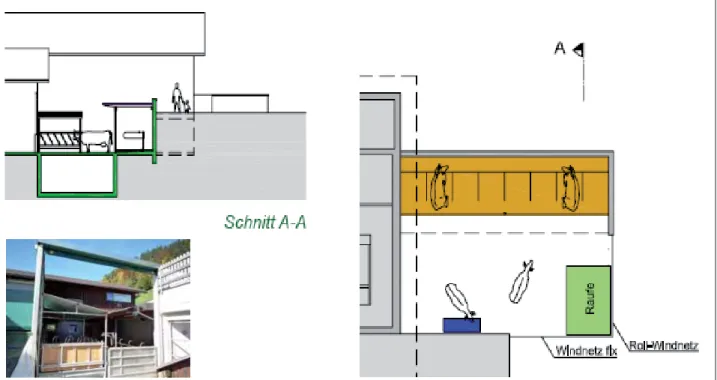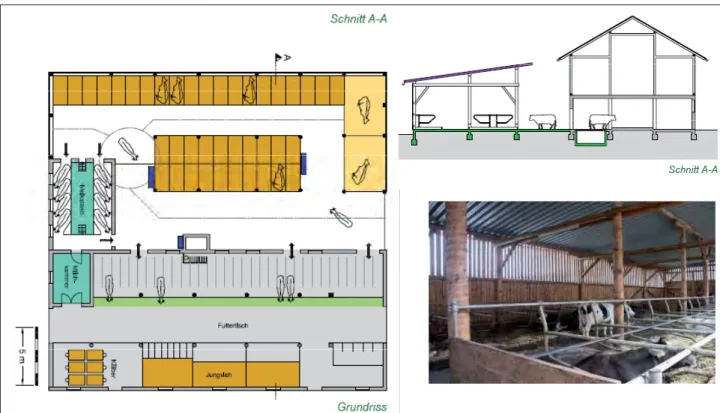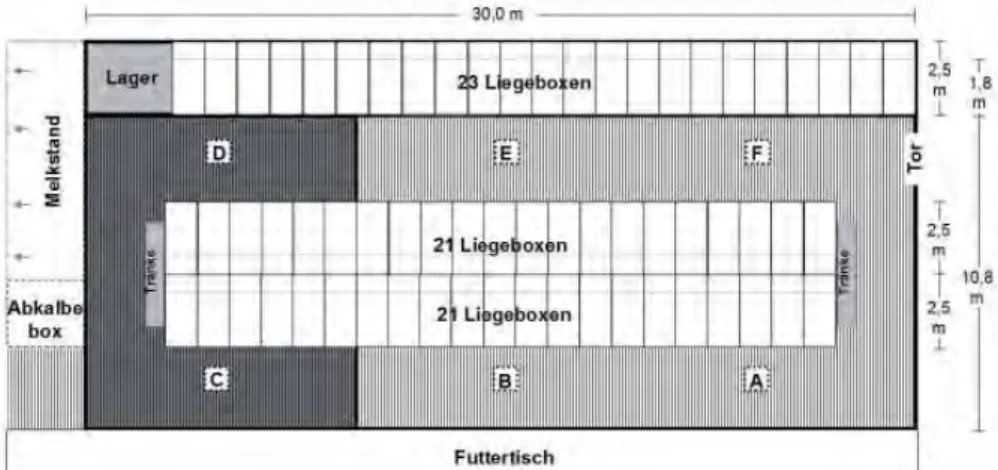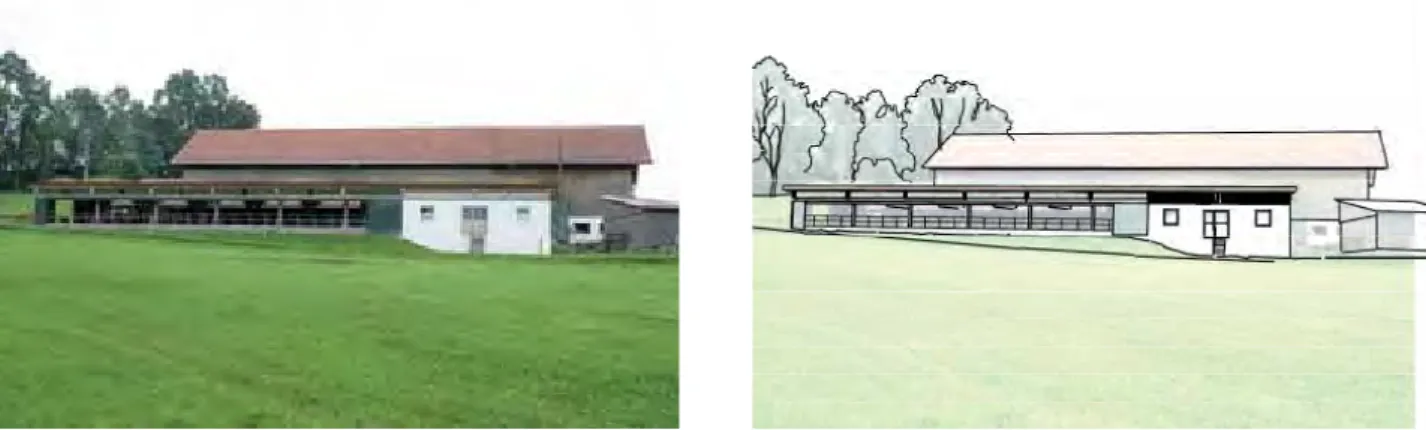In der Studie wurde die Kategorisierung der Gleitreibungswerte verfeinert und die Auswirkungen von Alterung und Restverschmutzung von Laufflächen aussagekräftig dargestellt. In der Praxis weisen insbesondere Hartbodenmaterialien häufig eine geringe chemische und mechanische Beständigkeit auf. Die Datenerhebung erfolgte auf 36 Milchviehbetrieben mit Liegeboxenställen in der Schweiz, Süddeutschland und Österreich.
Die Auswertung untersuchte den Einfluss von Bodenart, Jahreszeit und Sakralhöhe der Tiere auf die Schrittlänge mittels linearer Mixed-Effects-Modelle. Betonspaltenböden und Gussasphalt wiesen in der Kategorie < 0,3 μ mit 60 und 57 % ähnliche Verhältnisse der Gleitreibungswerte auf; Den höchsten Wert hat Beton mit Gummigranulat (83). Angaben zum Grenzwert für den Gleitreibungskoeffizienten μ finden sich in der Literatur zwischen 0,3 und 0,5 μ.
Die teilweise in der Literatur behaupteten Gleitreibungswerte von 0,4 μ können mit den untersuchten harten Werkstoffen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Rinderhufen nicht erreicht werden. In der vorgestellten Studie wurde die Kategorisierung der Gleitreibungswerte verfeinert und ermöglichte eine sinnvolle Darstellung der Auswirkungen von Alterung und Restverschmutzung.

Folgerungen für neue Materialien
Beton
Die Untersuchungen von KILIAN und STEINER (2007) haben gezeigt, dass unterschiedliche Oberflächenstrukturen allein anhand des Durchschnittswerts der Gleitreibung oft nicht ausreichend voneinander unterschieden werden können.
Gussasphalt
Elastische Gummiaufl agen
Literatur
Für die Versuche wurde ein biologisch bewirtschafteter Milchviehbetrieb (Bioland) in der Nähe von Trenthorst ausgewählt. Aus diesem Gesetz oder aus anderen bau- und raumplanerischen Vorschriften (z. B. Bauordnung, Bebauungsplan, Bebauungsplan, Bebauungsrichtlinie) können Regelungen abgeleitet werden, „die nicht nur dem Allgemeininteresse, sondern auch den Belangen der Anwohner dienen (öffentlich-rechtliche Einwendungen). )“ (in diesem Satz auch § 31 Abs. 4 Oö BauO 1994). Anschließend ist der prognostizierte Richtwert zu ermitteln, der die von den Nachbarn aufgrund der tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten zu erwartenden zusätzlichen Emissionen darstellt, die von der Anlage ausgehen oder auf sie zurückzuführen sind zu genehmigen, wobei – wie dargelegt – bei der Beurteilung der „(Un)angemessenheit“ die bestehende Grundgebühr zu berücksichtigen ist.
Allerdings ist zu beachten, dass die Beurteilung unzumutbarer Emissionsbelästigungen – wie oben bereits erwähnt – nicht von der Widmungskategorie abhängt. Darüber hinaus verweist die TA-Luft in Abschnitt 5.1.1 auf die sogenannten „Besten verfügbaren Techniken“, die im Rahmen der IPPC-Richtlinie der EU ermittelt wurden (siehe Kapitel 7). Es kann technisch unmöglich sein, eine Abdeckung anzubringen, wenn z. B. Die Dammprofile sind für deren Befestigung nicht geeignet.“
Emissionen aus der Tierhaltung (Rinder und Schweine) Lüftungsfehler in der Praxis Emissionen aus der Tierhaltung (Rinder und Schweine) Lüftungsfehler in der Praxis 50. Emissionen aus der Tierhaltung (Rinder und Schweine) Lüftungsfehler in der Praxis Emissionen aus der Tierhaltung (Rinder und Schweine) Lüftungsfehler in der Praxis 52. Dies ist jedoch ein Beweis dafür, dass die Reduzierung der Emissionen im Stall nur Vorteile bringt, sowohl für die Tiere selbst, für den Landwirt im Hinblick auf die Tiergesundheit und die damit verbundene Wirtschaftlichkeit und natürlich auch für die Umwelt bzw. die Umwelt Umgebung rund um diese Scheunen.
Dieses Zitat findet sich im Tagungsband der Bautagung Raumberg-Gumpenstein 2009 am Anfang des Artikels „ÖNORM: Messung und Bewertung von Schallemissionen im Bereich der Zwangslüftung“ (KROPSCH, 2009). Im Sinne eines gelungenen Zusammenlebens bei der Gebäudeentwicklung in der Landwirtschaft. Abluftgestaltung in der Schweine- und Geflügelhaltung entsprechend den Randbedingungen – Stand der Technik.
65 Abluftführung in der Schweine- und Geflügelhaltung im Verhältnis zur Nachbarsituation – Stand der Technik. Abluftführung in der Schweine- und Geflügelhaltung im Verhältnis zur Nachbarsituation – Stand der Technik 6565. 67 Abluftführung in der Schweine- und Geflügelhaltung im Verhältnis zur Nachbarsituation – Stand der Technik.
Abluftmanagement in der Schweine- und Geflügelzucht unter Berücksichtigung der Nachbarsituation – Stand der Technik 6767.
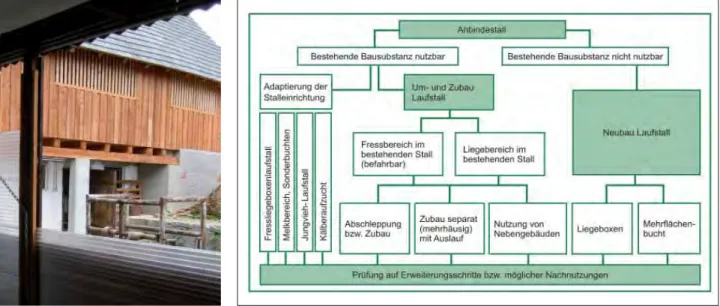
Karoversetzte Porendecken
Leider wird dem gesamten Bereich des stabilen Klimas in der landwirtschaftlichen Praxis immer noch oft eine vernachlässigte Rolle zugeschrieben. In den Ställen des Bildungs- und Wissenszentrums Boxberg wurden neue Zuluftsysteme installiert, die teilweise noch nicht in der Praxis umgesetzt wurden, wie z. B. Schachbrettmusterdecken und Bodenzuluft.
Die Unterfl urzuluftführung
Für die Güllespülleitungen mussten in den beiden Wandkojen zusätzliche Aussparungen angebracht werden. Auch die Kanten, auch an den Aussparungen für die Düngemittelrohre, waren völlig unbeschädigt. Der Vollkeller bietet den Vorteil einer Bodengestaltung, optimiert auf die Bedürfnisse der Sau und die Bedürfnisse der Ferkel.
Die hohe Fruchtbarkeit moderner Sauenherkunft erfordert auch eine Anpassung der Abferkelbuchten an das optimale Klima für Sauen und Ferkel sowie an den Platzbedarf der Ferkel in der Bucht. Daher ist Wärme für die Ferkel während der Geburt hinter der Sau und während der gesamten Säugephase ein wichtiger Faktor, um Ferkelverluste zu reduzieren. Bei geraden Ställen ergeben sich die Maße für die Breite aus der Breite der Standfläche der Sau von ca. 60 cm.
Ob die Sau quer oder parallel zum Futtergang untergebracht ist, ist für die Absetzleistung zunächst unerheblich. Auch Kombinationen aus Beton- und Metallböden können eine optimale Stand- und Liegefläche für die Sau bilden. Für die Ferkel ist es wichtig, die Tränkenäpfe so anzuordnen, dass ein konstanter Wasserfluss in den Leitungen gewährleistet ist.
Charakteristisch für den Welsh-Abferkelstall ist die klare Trennung der getrennten Funktionsbereiche Liegen, Fressen und Bewegen. Es muss eine überdachte Mindestfläche von 7,5 m2 vorhanden sein und das Gehege muss für die Tiere jederzeit zugänglich sein. Das Tierverhalten ist ein direkter Parameter zur Beschreibung des Wohlergehens und Wohlergehens von Haltungssystemen.
Ausschlaggebend für die Aktivität der Sau ist der zur Verfügung stehende Raum, der der Sau ein ungehindertes Drehen ermöglicht. Beim Üben des Nistverhaltens ist die Bereitstellung von geeignetem Nistmaterial und ausreichend Platz von entscheidender Bedeutung. Zur Untersuchung der Funktionalität der neu entwickelten Abferkelbucht wird die Dauer und der Ort des Brutverhaltens der Sau dokumentiert.
Über eine Ferkelluke von 20 x 30 cm ist der Auslauf für die Ferkel ab den ersten Lebenstagen leicht zugänglich. Gefährliche Situationen für die Ferkel innerhalb der ersten 3 Lebenstage (Häufigkeit) Biologische Leistungsfähigkeit • Futterbedarf der Sauen.

![Abbildung 4: Schrittlängen auf den Bodenmaterialien Gummi [Gu], Gussasphalt [Ga]](https://thumb-eu.123doks.com/thumbv2/pubdocorg/19313023.0/10.892.322.812.794.1124/abbildung-4-schrittlängen-bodenmaterialien-gummi-gu-gussasphalt-ga.webp)